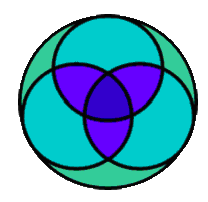| Start |
|
Natur |
|
Altertum |
|
Fernost |
|
Judentum |
|
Christentum |
|
Islam |
|
Sonstige |
Das
Christentum
Das Christentum entstand unmittelbar aus dem
Judentum. Das Alte Testament war bis zur Fertigstellung den Neuen Testaments
ebenfalls die alleinige Grundlage der Christen. Aus dem Judentum wurde die Lehre
übernommen, dass es einen Gott gibt, der als Schöpfer und Erhalter des
Universums gilt.
Dem christlichen Gott werden die Attribute Allmacht, Allwissenheit, Güte, Liebe,
Ewigkeit, Unveränderlichkeit und Unendlichkeit zugeschrieben. Die von Gott nach seinem Abbild geschaffenen Menschen leben mit
Gott in einem Bund. Der Mensch der Gott liebt und ehrt und seine Gebote befolgt,
wird nach dem Tod auf Erden in den Himmel auffahren und dort in Frieden leben.
Der Unterschied zum Judentum besteht in der
christlichen Anerkennung der 'Dreieinigkeit' Gottes. Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit oder
Trinität ist die christliche Lehre von der Dreiheit der gleich großen
Personen Vater, Sohn Jesus und Heiliger Geist in der
Einheit des "göttlichen Wesens".
Die bei der
Definition der Dreieinigkeit Gottes verwendeten Begriffe kommen in der Bibel
nicht vor und wurden erst viel später geschaffen und Zusammenkünften (Konzilen
etc.) der christlichen Gruppen festgelegt.
Noch im zweiten Jahrhundert galt, entgegen der Trinitätslehre, Jesus als
dem Vater Gott untergeordnet. Man hielt Jesus nicht für mächtiger als den Vater,
sondern geringer an Macht. Der Heilige Geist wurde wie der Sohn genau so dem
Vater untergeordnet. Im 2. und 3. Jahrhundert gab es unterschiedliche
Ansätze die Beziehungen zwischen Vater und Sohn theologisch zu formulieren.
Extremansichten wie der Adoptionismus (Jesus wurde bei der Taufe von Gott
adoptiert) und modalistischer Monarchianismus (der Vater und der Sohn
sind Erscheinungsformen des gleichen Gottes), existierten anfangs neben der
Trinität.
Im 1. Konzil von
Nicäa/Nizäa (325) wurde von den Kirchvätern die Dreifaltigkeitslehre festgeschrieben
und Jesus als der Sohn Gottes festgelegt. "Wir glauben an einen Gott
... und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als
Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist ... und an den Heiligen Geist.
Andere Ansichten wurden nun als Irrglaube dargestellt und verdammt. Initiator
des 1. Konzils von Nicäa war der römische Kaiser Konstantin I., der das
Christentum als Religion des Römischen Staates festschreiben wollte.
Konstantin erhoffte sich von der Förderung des Christentums ein stabilisierendes Element und
Religionsfrieden für die eben erst gewonnene Einheit seines römischen Reiches.
Konstantin sorgte auch dafür, dass Elemente aus anderen Glaubensrichtungen in das
Christentum überführt wurden, damit es den Anhängern aus anderen Religionen
leichter fiel in das Christentum zu konvertieren (z.B.
Festlegung der Geburt Jesus -> Weihnachtsfest auf den 25. Dezember, wo er den
heidnischen Feiertag Jul/Jol -> Winterfest der Germanen / Vergötterung der Sonne
verdrängte).
Die Anzahl der Christen wuchs durch die Maßnahmen Konstantins jedoch nicht
schneller an als zuvor. Die Christen wurden jetzt nur nicht mehr verfolgt und
konnten durch die staatliche Anerkennung ihre Strukturen festigen.
Da es nach dem
Konzil von Nicäa immer noch zu Unstimmigkeiten zwischen den Anhängern des
Arianismus und den übrigen Kirchenvertretern kam, wurde im Jahr 381 das 1.
Konzil von Konstantinopel einberufen, um den arianischen Streit beizulegen. Dort
wurde der Teil bezüglich des Heiligen Geistes genauer definiert:
"Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und
lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn
angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat
durch die Propheten."
Im Jahr 391 erhob Kaiser Theodosius I. das Christentum zur
Staatsreligion. Hohe Beamtenposten wurden von christlichen Würdenträgern
besetzt. Die einst verfolgte Minderheit im Römischen Reich, bekämpfte nun als
juristisch-bürokratische und mächtige Großorganisation das Heidentum.
Unterschied zwischen Dreieinigkeit und Dreifaltigkeit:
Das blau dargestellte Dreiblatt soll der dreigliedrigen Ausfaltung der
Aspekte Gottes darstellen: die Dreifaltigkeit. Das nach unten zeigende Blatt
symbolisiert Jesus als "Ausfaltung" aus dem Wesen Gottes, somit als
"Ausdruck Gottes" auf Erden. Im türkisen Dreipass mit Kreisen dagegen, deren
Berührungspunkte mit dem gemeinsamen Umkreis ein gleichseitiges Dreieck
bilden, sollen die sich gegenseitig umfassenden Aspekte des Gottesbegriffes
der Dreieinigkeit dargestellt sein. Umgangssprachlich wird zwischen
Dreieinigkeit (Dreipass) und Dreifaltigkeit (Dreiblatt) meist nicht
unterschieden, obwohl es theologische Diskussionen um den Unterschied der
beiden Begriffe gibt. Diese Ornamente werden oft in Kirchenfenstern
abgebildet. |
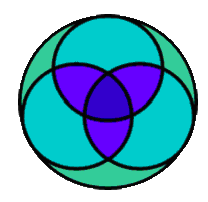 |
Göttliche
Triaden d.h. drei verschiedene, zusammengehörende Gottheiten bestehend aus
Vater, Mutter und Kind sind aus den meisten Mythologien bekannt (röm: Jupiter,
Minerva und Juno; ägypt: Osiris, Isis und Horus). Das semitische Wort für
'Geist' ist 'feminin' (hebräisch/aramäisch: רוח, ruach).
Im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht wie oben beschrieben Jesus (Christus,
Josua, Johosua) als der gleichberechtigte Sohn Gottes. Vor diesem Hintergrund versuche ich die historische Person
Jesus objektiv zu beschreiben und im Laufe der Zeit hinzu gedichtete Merkmale
wegzulassen.
Jesus
Jesus war der älteste Sohn von Joseph und Maria (vergl.
Bibel, Markus, 6,1.3). Joseph glaubte, dass Jesus unehelich gezeugt worden sei,
bis ein Engel ihm den wahren Grund erklärt habe (vergl. Bibel, Matthäus
1,19.20). Auch einige Stellen des jüdischen Talmud stellen Jesus als uneheliches
Kind dar. Der Historiker Gerd Lüdemann greift diese gewagte These auf und vermutet ein
Römer habe Maria vergewaltigt. Daraus erklärt er sich, dass Jesus als „Sohn der
Maria“ anstelle des üblichen „Joschua ben Joseph“ genannt wurde.
Sein
Geburtsjahr wird nach Julius Sextus Africanus im Jahr 2 v.Chr., nach Anianus für
das Jahr 9 n.Chr. errechnet. Heutige Vermutungen schwanken zwischen beiden
Angaben.
Jesus hatte vier Brüder
(Jakobus, Joses, Judas und Simon) und mehrere Schwestern (vergl. Bibel, Markus 6,3).
Die Geburt in einem Stall in Bethlehem, sowie die Flucht nach Ägypten usw. sind
eher Legenden und entbehren einer historischen Belegbarkeit. Es wird davon
ausgegangen, dass das Neue Testament mit der Jesus' Geburt in Bethlehem
angereichert wurde, damit die Aussage aus dem Alten Testament stimmt, dass der
Messias aus dem Ort Bethlehem hervorgehen würde.
Joseph war Bauhandwerker (Tekton) und lebte mit seiner Familie in Nazareth/Galiläa.
Sein Sohn Jesus scheint in Nazareth sein Handwerk erlernt und ausgeübt zu haben.
Hinweise auf bauhandwerkliche Kenntnisse finden sich in der Bibel z.B. als Jesus
in einer Erzählung von einem Stein berichtet, den die Bauleute verworfen haben
und letztendlich zum Eckstein wird.
In Nazareth werden zu Jesus Zeiten laut
Ausgrabungen etwa 200 Einwohner gelebt haben. Das Dorf unterhielt aber bereits eine kleine
private Synagoge. Jesus wird demnach in einer frommen jüdischen Umgebung
aufgewachsen sein. Wie damals üblich, wird Jesus zu den großen Wallfahrtsfesten
nach Jerusalem gepilgert sein (vergl. Bibel, Lukas 2,41) und sich frühzeitig mit
religiösen Fragen auseinandergesetzt haben müssen. Da zu einer Synagoge auch
eine Elementarschule gehörte, wird er wie alle seiner Stammesgenossen im Lesen
der Hebräischen Bibel unterwiesen worden sein (vergl. Bibel, Lukas 4,16).
Einige Juden glaubten zur dieser Zeit an ein bevorstehendes Weltuntergangszenario für
die Jahre 27/28 n.Chr. Es muss davon ausgegangen werden, dass auch Jesus
früh ein Anhänger dieser Lehre war. Dies würde erklären, dass er wie viele seiner
Stammesgenossen zu Johannes dem Täufer pilgerte, sich seine Lehren anhörte
und sich taufen ließen.
Der Priestersohn Jochanan ben Sacharja, genannt Johannes der Täufer,
bestritt in seinen Lehren, dass das jüdische Volk allein durch seine Erwählung
durch Gott das Himmelreich sicher wäre. Johannes verkündete, dass Gott den Juden
durch ihn eine letzte Chance zur Buße geben würde, bevor das letzte Gericht
anstehe. Die Juden sollten sich durch ihn mit dem Wasser des Jordan taufen
lassen, um die Vergebung der Sünden zu erlangen (verg. Bibel, Markus 1,4-5).
Diese Verkündung bedeutete für den Großteil der Juden ein skandalöses Verhalten
und sorgte für viel Aufsehen. Johannes unterhielt zur Unterstützung seiner
Arbeit einen engeren Jüngerkreis, der auch seine Überlieferungen bewahrte (siehe
Bibel, Markus 2,18). Johannes verkündete einen Messias/Erlöser als letzten
Gottesboten gemäß des 'Buches Daniel' in Gestalt eines Richters (siehe Bibel,
Daniel, 7,13(14 u.26)).
Wie lange Jesus bei Johannes dem Täufer verbracht hatte ist ungeklärt. Eventuell
lernte er bei Johannes die Brüder Simon (gen. Petrus) und Andreas kennen und warb sie ihm
als Jünger ab
(vergl. Bibel, Johannes 1,35–42). Nach der
Begegnung mit Johannes dem Täufer kehrte er nach Galiläa zurück und
lehrte selbst die frohe Botschaft von dem bevorstehenden Gottesgericht. Mit dem
Unterschied, dass er die Lehre von Johannes dem Täufer aufgriff und weiterführte
und sich für den prophezeiten Messias einsetzte. Jesus war zu dieser Zeit etwa
30 Jahre alt (vergl. Bibel, Lukas 3,23).
Jesus sammelte nun selbst einen Jüngerkreis um sich, die er mit seinen und
den Lehren Johannes des Täufers vertraut machte und wanderte mit diesen
erwählten 12 Jüngern (Simon (gen. Petrus), Jakobus (Sohn des Zebedäus),
Johannes, Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus (Sohn des
Alphäus), Thaddäus, Simon (Kananäus) und Judas) und weiteren 70 Männern und
Frauen (erweiterter Jüngerkreis) in die angrenzenden Gebieten Galiläas und
verkündete den dort lebenden Menschen seine Überzeugungen. Jesus kümmerte sich
hauptsächlich um das einfache Volk Galiläas (vergl. Bibel, Matthäus 11,28) und
stellte ihnen nach einem mühseligem Leben auf Erden eine Entschädigung im
Jenseits in Aussicht. Aufgrund seiner offensichtlich besonderen Gabe der
Erklärung, gepaart mit fundiertem Wissen der Schriften, überzeugte er
viele Menschen von seinen Glaubensvorstellungen. Seine gesamte öffentliche
Tätigkeit wird zwischen einem und höchstens drei Jahren gedauert haben. Dies ist
für die tief greifende Wirkung die seine Lehren erzeugt haben ein beachtlich
kurzer Zeitraum.
Eine sehr gewagte These im Leben Jesus ist die, dass Jesus verheiratet gewesen
sein soll. Zeugnis dieser Vermutung ist die Hochzeit in Kana(an) (vergl. Bibel,
Johannes, 2,1-12). Einige Bibelforscher gehen davon aus, dass es sich bei den
Beschreibungen um die eigene Hochzeit Jesus gehandelt haben soll, da er in der
Erzählung als Hausherr und Bräutigam agiert und sich um die Versorgung der Gäste
kümmerte. Als Frau des Jesus wird Maria Magdalene (auch Maria Magdalena Maria
aus Magdala; Bibel, Matthäus 27, 56.61; Matthäus 28,1-9; Markus 15,40.47; Markus
16,1.9, Lukas 8,2; Lukas 24,10; Johannes 19,25; Johannes 20, 1.11.16.18)
gesehen, die ihn Zeit seines Wirkens bis zum Tod begleitet hat und der er nach
seiner Auferstehung von den Toten als erstes begegnet sein soll. Falls er ein
ausgebildeter Rabbi war, wäre er laut Mischnah zur Ehe verpflichtet gewesen. Da
er dem Verkünden des Reiches Gottes Vorrang vor allen weltlichen Bindungen gab (vergl.
Bibel, Matthäus 6,33), kann er unverheiratet und sexuell enthaltsam umhergezogen
sein.
Die Erfolge die Jesus bei seinen Verkündigungen erzielte, waren den altjüdischen
Schriftgelehrten, Sadduzäern, Pharisäern und auch den Römern natürlich ein Dorn im Auge. Sie fürchteten den
Einfluss auf das einfache jüdische Volk zu verlieren und mussten schnell handeln. Als
Jesus zum Pessachfest nach Jerusalem pilgerte, wurde er gefangen genommen. Die
Festnahme des Jesus schien aus politischen und religiösen Gründen notwendig
geworden sein. Sein Auftreten im Tempelbezirk hätte einen Volksaufstand beim
bevorstehenden Passahfest auslösen können. Das hätte unvermeidlich das
Eingreifen der Römer, blutigen Kampf und das Ende der religiösen Autonomie
Israels provoziert. Unter
der Beschuldigung Falschprophetie begangen zu haben, wurde ihm unter dem
römischen Prokurator Pontius Pilatus (Amtszeit zwischen 26 bis 36 n.Chr.) der
Prozess gemacht und zum damals gängigen Tod am Kreuz verurteilt. Nach allen
Evangelien verurteilte Pilatus Jesus als „König der Juden“, wie es auf der
Kreuztafel in Lateinisch, Griechisch und Hebräisch vermerkt wurde, die wie bei
Römern üblich, den Grund des Todesurteils angab (vergl. Bibel, Johannes
19,19). Demnach hielt Pilatus Jesus für einen Rebellenanführer, der Israels
Hoffnung auf Befreiung von der Fremdherrschaft bestärkte. Er wollte gegen alle
rebellischen Juden ein Exempel statuieren. Denn ein Messiasanspruch war nach
römischem Recht Hochverrat, Anstiftung zum Aufstand oder bereits selbst
staatsfeindlicher Aufruhr.
Zum Todestag des Jesus gibt es mehrere Versionen. Da laut Bibel sich zum Tod
Jesus am Tag eine Sonnenfinsternis ereignet haben soll (Bibel, Matthäus 27, 45;
Markus 16,33), kommt der 07.April 30 oder der 3.April 33 in Betracht. Der
07.April war ein 'dies nefastus' an dem nach römischen Recht keine
Gerichtsverhandlung stattfinden durfte. Verbleibt demnach nur Freitag der
3.April 33.
Am dritten Tag nach seinem Tod soll Jesus wiederauferstanden sein, sich
einigen seiner Getreuen gezeigt haben und anschließend zu Gott in den Himmel
aufgefahren sein.
Glauben
Die Christen glauben an :
- den einen Gott (in seiner Dreifaltigkeit),
- die Nächstenliebe (von Jesus aus den Büchern Moses zusammengefasst): "Du
sollst lieben Gott deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von
allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten lieben wie dich selbst"
(Bibel, Levitikus 19,18; Deuteronomium 6,5)
- die Zehn Gebote (aus christlicher Sicht eigentlich
nur 8 Gebote des Moses)
1. Ich bin Jahwe,
dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus (Diese
Aussage wird von den christlichen Kirchen nicht als Gebot anerkannt, dafür
wird das hier genannte 10.Gebot in zwei Gebote aufgeteilt)
2. Du sollst neben
mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbildnis machen, das irgendetwas darstellt am
Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht
verpflichten, ihnen zu dienen ...
3. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen ...
4. Achte auf den Sabbat (Sonntag): Halte ihn heilig ... Sechs Tage darfst du
schaffen und jede Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn,
deinem Gott geweiht. (Dieses Gebot wird im Neuen Testament nicht
wiederholt/anerkannt und bildet eine Ausnahme bei den Christen)
5. Ehre deinen Vater und deine Mutter ...
6. Du sollst nicht morden
7. Du sollst nicht die Ehe brechen
8. Du sollst nicht stehlen
9. Du sollst nichts Falsches
gegen deinen Nächsten aussagen
10. Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, und du sollst
nicht das Haus deines Nächsten begehren, nicht sein Feld, seinen Sklaven oder
seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel, nichts was deinem Nächsten gehört.
(Bibel, Deuteronomium, 5,7-21)
- den Tag an dem die Welt untergeht, mit anschließender Auferstehung, einem
Jüngsten Gericht und bei Wohlgefallen unter den Augen Gottes ein ewiges Leben
Die
Glaubensrichtungen
Seit der Begründung der christlichen Lehre haben sich im Laufe der Zeit
verschiedene Glaubensrichtungen entwickelt. Durch Anklicken der nachfolgenden
Begriffe können Sie näheres zu den verschiedenen Kirchen erfahren:
- Katholische Kirche
- Orthodoxe Kirche
- Assyrische Kirche
- Altorientalische Kirchen
- Evangelisch-lutheranische Kirche
- Evangelisch-reformierte Kirche
- Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK)
Lutherische Bekenntniskirche
- Evangelische Freikirchen (Täufer, Mennoniten,
Baptisten,
Methodisten,
Pfingstbewegung , Anglikanische Kirche,
Apostolische Kirchen
- Neuapostolische
Kirchen
- Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage
- Zeugen Jehovas (nicht Dreifaltigkeit)
- Gnostizismus (christliche Mystik)
Übrigens ...
Das Wort 'Gott' stammt aus dem germanischen
Sprachgebrauch. Bezeichnungen sind mittelhochdeutsch/ althochdeutsch 'Got',
gotisch 'Guth', englisch 'God', schwedisch 'Gud'. Sämtliche
Bezeichnungen gehen auf das
(durch Zauberwort)
Anrufen (germ.: ghuto / ghau) eines übernatürlichen Wesens
zurück, welches ursprünglich sächliches Geschlecht hatte, weil es
männliche und weibliche Gottheiten zusammenfasste. Nach der Christianisierung
wurde das Wort umgedeutet und im gesamten germanischen Sprachbereich als
Bezeichnung des meist als männlich empfundenen Christengottes verwendet. Seitdem
ist es nur noch unter 'Der Gott' bekannt. Dem Ursprung nach würde der
Begriff aber 'Das Gott' heißen.
'Theos',
das griechische Wort für Gott, entstammt wohl dem Verb 'theo' ->
'platzieren'. 'Theos' ist demnach wörtlich ein Platzierer / ein
Unterordner.
Der jüdische und christliche Gott trägt den Eigennamen 'Jhwh'
(vermutete Aussprache: 'Jahwe', fälschlicherweise oft 'Jehova'),
der in den Bibeln oft durch den Titel „Herr“ ersetzt ist. Außerdem werden
einige weitere Namen und Namenszusätze für Jahwe verwendet, darunter 'Zebaot'
(auch
'Sabaoth', deutsch:
'Herr der Heerscharen').
Weblinks zum
Christentum
Quellen:
Bibel, 1996, Schwabenverlag AG, Ostfildern
Harenberg, Lexikon der Religionen, 2002, Harenberg Verlags- und Medien GmbH,
Dortmund
Peter B. Clarke u.a., Atlas der Weltreligionen, 1993, Mohndruck GmbH, Gütersloh
Emma
Brunner-Traut, Die Stifter der großen Religionen, 1994, Verlag Herder,
Freiburg
Gustav Mensching, Die Weltreligionen, 1981, Drei Lilien Verlag, Wiesbaden
Helmut von Glasenapp, Die fünf Weltreligionen, 1996, Eugen Diedrichs Verlag,
München
www.wikipedia.de